

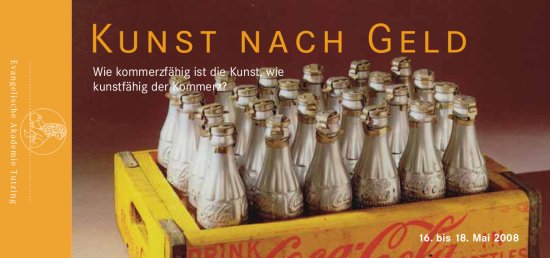

|
„Es
geht
nicht darum einzelne Sammler, Galeristen oder Institutionen zu
kritisieren (doch auch), sondern darum, wie sie sich alle
einfügen einen Gier- und Ausbeutungszusammenhang und wie sie
alle gemeinsam der Legitimierung einer globalen kapitlistischen und
neoliberalen Wirtschaftsordnung zuarbeiten. Denn diese
Ökonomie ist der
Spiegel ihrer Eitelkeiten, dort im Wettbewerb schult sich ihr
Geschmack, dort zeigt sich der Erfolg und Misserfolg ihrer Sammlungen.
Institutionen, Sammler und ihr Markt haben es in den letzten 20 Jahren geschafft jede Dissidenz, jede Kritik an ihrerem Einfluss auszugrenzen und ruhig zustellen. Angefangen vom kunstinteressierten Gymnasiasten, den Studierenden der Akademien, den jungen und nicht mehr jungen Künstlern, den Galeristen, Kuratoren, Kritikern, Sammlern, Institutsleitern, Investoren, Spekulanten... wir sehen eine einzige affirmative Kette, ein Zuarbeiten auf das, was allgemein als Erfolg angesehen wird: die Teilnahme an einem globalen Glamour- und Geldkarussel, ein gegenseitiges und einvernehmliches Image Making und Branding das auf die Anhäufung fiktiven Kapitals hinarbeitet. Unausgesprochen werden dadurch alle auf diesem Weg liegenden und daraus resultierenden Ausbeutungsprozesse legitimiert. Das sind nicht nur die Ausbeutungsprozesse innerhalb des erwähnten Reigens, sondern der Reigen arbeitet der Glorifizierung eines Prinzips zu, um wissentlich oder nicht, dessen ausbeuterischen Verkettungen weltweit zu übertünchen. Verwundert fragt man sich vor diesem Hintergrund warum im kulturellen Feld es keinen aktiven Widerspruch dagegen gibt. Und im Gegenteil - das 68er Bashing wurde ein beliebtes Spiel in den Feuilletons, der Vormarsch von Malerstars und Egoperformern, und in der Literatur der Büchnerpreis für den unsäglichen Mosebach - die vergangenen zehn Jahre waren geprägt von einer Mobilmachung einer neuen konservativen Rechten. Überdies leben wir aus Furcht vor den zunehmenden sozialen Konflikten in einem Sicherheits- und Überwachungsstaat und internalisieren diesen Kontrollwahnsinn, befinden uns konstant in gegenseitigen Überwachungsverhältnissen. Wie verhält sich nun der Künstler im Corporate Rokoko? Bleibt ihm nichts anderes übrig als zum devoten Höfling zu mutieren, zum feingeistigen Opportunisten, der zur Ausstattung der corporaten Repräsentationsgier und Ausbeutungeverhältnisse beiträgt, ist er derjenige der mit geschickten Strategien immer neue, verführerische Waren produziert? Wie könnte es gelingen die veränderte Rolle der Kunst und der Künstler in den geänderten Umständen zu reflektieren um ihre Rollen kritisch umzuschreiben? Wie würde sich eine für eine gesellschaftsverändernde Neuverortung von Kunst notwendige kritische Öffentlichkeit konstituieren? Eine Antwort hierauf will ich mit den beiden Begriffen Forschung und Selbstorganisation versuchen: Forschung wäre zu verstehen als Untersuchung der vielen Unwägbarkeiten und Probleme mit denen wir künstlerisch wie gesellschaftlich zu tun haben. Aber diese Forschung könnte nur dann an die Wurzel gehen, wenn sie frei, d.h. ohne Kontrolle stattfinden kann. Auf Universitäten und andere Institutionen ist aber, wie wir gesehen haben, diesbezüglich kein Verlass. Eine kritische Forschung wird also nur dort radikal werden können wo sie sich selbst organisiert, wo sie im eigenen Auftrag stattfindet, wo sie „Non-aligned“ ist (... und das weiß auch Siemens). Selbst-organisation ist aber nicht Selbst-hilfe, denn Selbsthilfe ist ein durch den Kapitalismus zugewiesener letzter Ort für die Ausgeschlossenen. Schon im neunzehnten Jahrhundert hat sich der Arbeiterführer Lassalle gegen Selbsthilfe ausgesprochen. Er plädierte stattdessen für Selbstbildung, denn gegenüber einem gebildeten Arbeiter würden sich die Kapitalisten nicht trauen Hungerlöhne zu bezahlen. Selbstorganisation ist kein Karrieremodell, keine Ich-AG, kein 'self-enrepreneurship'. Es geht nicht darum mittels Selbstorganisation am herrschenden System, Kapitalismus, teilzunehmen. Denn in der Selbstorganisation geht es darum, das herrschende System auszuhebeln. Es geht um eine grundlegende Infragestellung der herrschenden Ideologie und ihrer Ökonomie. Und in unserem Falle ist die Ökonomie die Ideologie. Um also einen Hebel anzusetzen ist die Vorstellung und Konstruktion eines AUSSEN wichtig. Und diejenigen, die behaupten, es gäbe kein außerhalb der herrschenden kapitalistischen (Un-)Ordnung, die treiben die allgemeine Hofflungslosigkeit nur noch weiter. Das ist in meinen Augen momentan das konservativste Argument, eine Art Desillusionierungspolitik, betrieben durch diejenigen die sich der Gewinnerseite zurechnen. Und selbst wenn es (objektiv?) kein Außen gäbe wäre doch die Setzung – und wir müssen uns auch als Künstler begreifen – die Konstruktion eines Außen, eine neue wichtige Aufgabe. Dieses Außen ist aber in meinen Augen kein ein tatsächlicher Ort "dort draussen" und keine weitere Utopie, kein Religionsersatz, dieses Aussen setzt hier an, und es ist eine Bewegung nach Draussen und diese Bewegung nimmt ihren Ursprung in der Selbstorganisation und Forschung. Und dieses Aussen, die Bewegung einer radikalen Politik hin zu einer grundlegenden Gesellschaftsveränderung, setzt überall an: Opensource, Nahrung, Kleidung... jeder Schritt, jede Entscheidung kann seinen Teil zu dieser Bewegung beitragen. Jeder Stein der auf der Straße ist eine Möglichkeit ein Aussen zu konstruieren. Deswegen meine Kritik des neue Ehrlichkeitsdiskurses, denn der findet lediglich innerhalb einer völlig abgesicherten Konstruktion von Markt, Macht und Gesellschaft statt. Er will die strukturellen Bedingungen und Beschränkungen in dem er sich bewegt gar nicht in Frage stellen oder verändern, er ist ein Trick, eine neue Rhetorik, Werte erhaltend, rückwärts gewendet, konservativ.“ |